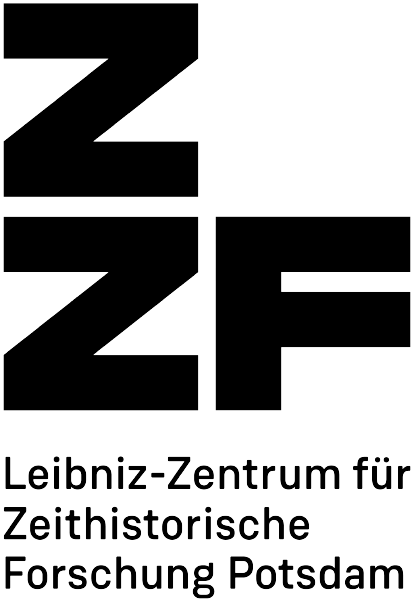Arbeit
Refine
Year of publication
Document Type
- Journal Article (50)
- Online Publication (39)
- Part of a Book (15)
- Book (3)
- Preprint (1)
Keywords
- Computer (2)
- Deutschland (Bundesrepublik) (2)
- Deutschland (DDR) (2)
- Arbeitsbedingungen (1)
- Automobilwerk Eisenach (1)
- Begriffe (1)
- Computerunterstütztes Verfahren (1)
- Datenverarbeitung (1)
- Deutschland (Östliche Länder) (1)
- Forschungsfelder (1)
Wie verarbeiten Menschen die neuen Anforderungen der Arbeitswelt? Wie gehen sie mit ständiger Verfügbarkeit, wechselnden Arbeitsorten oder plötzlichen Entlassungen um? Der Soziologe Richard Sennett (geb. 1943) war 1998 dem »Zauberwort des globalen Kapitalismus« (Klappentext) auf der Spur: der »Flexibilität«. Sein Hauptinteresse galt dem Wandel der Arbeit in den USA und den Konsequenzen für die arbeitenden Menschen. Das Repertoire der Politökonomie-Analyse marxistischer Provenienz machte er sich dabei bewusst nicht zu eigen. »Der Fehler des alten Marxismus« sei es gewesen, dass in ihm »keine Menschen vorkamen, sondern lediglich Kategorien«. Die Vertreter:innen dieses Marxismus hätten sich nicht darauf eingelassen, die »Verwirrungen gelebter Erfahrungen zu betrachten«. Solche Erfahrungsbrüche stehen im Mittelpunkt von Sennetts zeitdiagnostischem Essay »The Corrosion of Character«. Der Berlin-Verlag gab der deutschen Ausgabe den griffigen Titel »Der flexible Mensch«. Das Buch wurde international zum »Longseller«, und Sennett erhielt in Deutschland diverse hochdotierte Preise. Laudator:innen und Kommentator:innen aus verschiedenen politischen Richtungen waren sich einig: Sennett habe eine wichtige und eingängige Gegenwartsdiagnose vorgelegt.
Wolfsburg wurde, mehr noch als andere Städte, von Zuwanderung geprägt. Insbesondere „Gastarbeiter“ aus Italien und ihre nachgezogenen Familien machten seit den 1960er Jahren einen großen Anteil der Bevölkerung und insbesondere der Belegschaft des Volkswagenwerks aus. Sie prägten die Stadt auch als Gründer:innen zivilgesellschaftlicher Initiativen, als Unternehmer:innen oder Angestellte der Kommune. In den letzten Jahren fand diese Facette Wolfsburgs zunehmend auch Niederschlag in der stadtgeschichtlichen Forschung sowie der lokalen Erinnerungspolitik.
In diesem Kontext wurde der 60. Jahrestag der Ankunft italienischer Arbeiter in Wolfsburg im Jahr 2022 mit der Ausstellung „Percorsi di vita. Lebenswege nach Wolfsburg“ gewürdigt, die von der Stadt Wolfsburg und der dortigen italienischen Konsularagentur gefördert wurde. Hierzu erschien eine gleichnamige, reich bebilderte Begleitpublikation. Kern des Bandes sind zwölf kurze Graphic Novels, die von den Künstler:innen Hannah Brinkmann, Magdalena Kaszuba, Birgit Weyhe, Lukas Jüliger, Joachim „Ali“ Altschaffel und Jeff Chi gestaltet wurden.
In der Arbeitswelt der DDR bestanden markante soziale Ungleichheiten, die sich mit der Vereinigung verschärften.
Die Gesellschaft der DDR war stark über die Arbeit im Betrieb organisiert, die wesentlich zur »Vergesellschaftung« beitrug. Da Betriebe das soziale und materielle Leben organisierten, prägten sie auch soziale Ungleichheit, obwohl sich die DDR als egalitäre Gesellschaft verstand. Jessica Lindner-Elsner untersucht am Beispiel des VEB Automobilwerk Eisenach, das den Wartburg baute, wie sich Arbeitsbedingungen und soziale Ungleichheit wandelten. Dies zeigt sie für die Kernbelegschaften und vulnerable Arbeiter:innen wie etwa Strafgefangene, Menschen mit Behinderungen und Ausländer. Sie waren gegenüber Mitarbeiter:innen in Normalarbeitsverhältnissen benachteiligt. Deutlich wird zudem die Ungleichbehandlungen von Frauen, die aufgrund fortbestehender Rollenverteilungen weniger flexibel auf Arbeitsanforderungen regieren konnten.
Die Autorin fragt, wie solche Benachteiligungen im planwirtschaftlichen System entstanden. Ebenso zeigt sie, wie sich die Muster sozialer Ungleichheit im Übergang zur Marktwirtschaft veränderten, als das Automobilwerk durch die Treuhandanstalt abgewickelt wurde und mit Opel in Eisenach ein neuer Hersteller übernahm.
Die »Wende« als Form der Kolonisierung? Zur Genese und Aktualität eines populären Deutungsschemas
(2023)
Bei der Lektüre des 2023 erschienenen Bestsellers »Der Osten: eine westdeutsche Erfindung« von Dirk Oschmann sowie beim Nachvollzug der bisweilen heftigen Diskussionen, die dieses Buch ausgelöst hat, bekommt man unweigerlich das Gefühl, einer Orientalismus-Debatte 2.0 beizuwohnen. Zur Erinnerung: Edward Saids 1978 publiziertes Buch »Orientalism«, in dem ausgehend von primär wissenschaftlicher Wissensproduktion die koloniale Zurichtung und Erfindung des Orients beschrieben und kritisiert wird, gilt gemeinhin als einer der Gründungstexte postkolonialer Kritik. Tatsächlich lesen sich die Ausführungen des Leipziger Literaturwissenschaftlers Oschmann stellenweise so, als ob Ostdeutschland und die Ostdeutschen einem westdeutschen Zugriff quasi hilflos ausgeliefert wären. Gerade diese Zuspitzung wurde von einigen Kommentator*innen kritisiert, ähnlich wie bei der Orientalismus-Debatte im Anschluss an Said. Überhaupt fällt auf, dass Oschmann, wenngleich er sich nicht systematisch mit postkolonialer Theorie auseinandersetzt, so etwas wie eine postkoloniale Rhetorik in Anschlag bringt. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle, »dass die Art und Weise, was und wie über ›den Osten‹ öffentlich geredet, geschrieben und gesendet wird, in Form von konstant negativen Identitätszuschreibungen und Essentialisierungen, komplett vom ›Westen‹ beherrscht und durchherrscht ist«. Zudem fällt auf, dass zwar auch der Kolonisierungsbegriff nicht systematisch zum Einsatz kommt, gleichwohl aber der Kolonialismus als historische Referenz erwähnt wird: »Dem Osten […] ›Demokratiefeindlichkeit‹ vorzuwerfen, ist nicht nur zynisch, sondern folgt obendrein einem seit Jahrhunderten eingeführten Herrschafts- und Diskursmuster, mit dem der westliche Kolonialismus verschiedener Couleur seine Hegemonie zu begründen sucht.« Ostdeutschland also als westdeutsche Kolonie? Und postkoloniale Kritik als Analyse-Tool für postsozialistische Dynamiken?
Wahrnehmungen, Gebrauchsweisen und sozioökonomische Folgen der Computernutzung bis zum Aufkommen des PCs.
Die Verbreitung des Computers zählt zu den wichtigsten Veränderungen der jüngeren Zeitgeschichte. Bereits seit Mitte der 1950er Jahre setzten zunächst große Unternehmen und Behörden, dann auch das Militär und Sicherheitsdienste zunehmend Computer ein. Die Zeitgenossen diskutierten intensiv die Auswirkungen der Computernutzung und bewerteten sie als einen tiefgreifenden Umbruch. Dennoch hat sich die Zeitgeschichtsforschung bislang kaum mit dem Beginn des digitalen Zeitalters beschäftigt.
Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes untersuchen die Verbindungen zwischen technischem und gesellschaftlichem Wandel als einen evolutionären Prozess, der selten gradlinig verlief. Klassische Themen der Zeitgeschichtsforschung, wie die Geschichte der Inneren Sicherheit, des Wohlfahrtsstaats und des Bankenwesens, der Arbeitswelt, der Verwaltung, aber auch von Protest- und Subkulturen werden auf diese Weise neu betrachtet. Dabei wird aufgezeigt, inwieweit Computer die Kontroll-, Betriebs- und Machtgefüge veränderten. Die Bundesrepublik steht im Vordergrund, jedoch mit vielfältigen Seitenblicken auf grenzübergreifende Verflechtungen.
Da das Recht und damit auch der Strafvollzug dem Aufbau des Sozialismus dienten, ist anzunehmen, dass diese sozialistische Moral auch in den Gefängnissen vermittelt werden sollte. Wie wurde also in den DDR-Haftanstalten mit gleichgeschlechtlicher Sexualität und nicht-normativen Verkörperungen von Geschlecht umgegangen? Dieser Frage geht der Beitrag am Beispiel des Ost-Berliner Frauengefängnisses nach.
Es ist etwas in Bewegung geraten in der ohnehin komplizierten deutsch-deutschen Erinnerungslandschaft. Nach dreißig Jahren wandeln sich die Rückblicke auf die jüngste Vergangenheit. Im Fokus steht dabei die Zeitenwende von 1989/90, die Deutschland und Europa wieder intensiv umtreibt. Eine neue Welle von Populismen und Nationalismen spült scheinbar vergessene, verdrängte oder überwunden geglaubte Fragen zu den materiellen wie ideellen Erbschaften von Staats- und Postsozialismus erneut an die Oberflächen. Als zuletzt auch die sonst in dieser Hinsicht so schweigsame Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview gegenwärtig – angesichts bisweilen heftiger publizistischer Debatten – ein ostdeutsches „1968“ aufdämmern sah, wurde offensichtlich: Vormals festgefügte Meister- beziehungsweise Siegererzählungen (West?) und hierauf bezogene Gegen- beziehungsweise Opfererzählungen (Ost?) werden brüchig und verlieren an Überzeugungs- und Bindekraft.Politische, generationelle, wissenschaftliche und kommunikativ-technologische Dynamiken überschneiden sich in einem nur schwer überschaubaren Geflecht aus vielfältigen Interessen, Meinungen und Emotionen. Und mittendrin: eine gerade erst dieses neue Feld empirisch für sich entdeckende Zeitgeschichtsforschung.
Schwarze Löcher
(2019)
Im Jahr 1993 oder 1994 zeigte mir mein Vater ein wackeliges Video. Er und seine ehemaligen Arbeitskollegen hatten gemeinsam ein Schwein aufgezogen, und nun sollte jeder seinen Anteil bekommen. Im Video sah man, wie die Sau über den Hof getrieben wird, dann bindet sie jemand am Hinterlauf fest. Das Tier wird „Wessi“ getauft. Die Männer johlen, das Bier fließt. Dann wird Wessi mit einem Bolzenschussgerät niedergestreckt, das Schwein zappelt am Boden, jemand sticht in die Halsschlagader, das Blut strömt in einen bereitgestellten Bottich. Mein Vater wirft sich auf die Sau, um sie zu fixieren. Es ist der 7. Oktober, das Datum des ehemaligen „Tags der Republik“ der DDR. Das Schwein wird mit kochendem Wasser übergossen und abgeschabt. Wessi wird zu Wurst verarbeitet.
Die Einheit als „soziale Revolution“. Debatten über soziale Ungleichheit in den 1990er Jahren
(2019)
Die DDR-Sozialpolitik vermittelte Sicherheit und Geborgenheit, das „Recht auf Arbeit“ war verfassungsmäßig verankert – all dies besaß einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf soziale Strukturen und Wertorientierungen für die Zeit nach 1990. Diese Erfahrungen waren tiefgreifend und zentraler Vergleichsmaßstab in einer Zeit, in der individualistische Strategien der Daseinsbewältigung zunehmend wichtiger werden sollten. Mit den Unwägbarkeiten der postindustriellen Gesellschaft hingegen war die Bundesrepublik seit Mitte der 1970er durch die Erfahrung von (Massen-)Arbeitslosigkeit und den Auswirkungen des globalen Strukturwandels bereits konfrontiert. Hier wie dort existierten Ungewissheiten und soziale Unsicherheiten, die das Zustandekommen damaliger Wahrnehmungsweisen sozialer Umbrüche erklären. Dergestalt ist der damalige Umgang mit sozialer Ungleichheit ein besonders frappierendes Beispiel für die umkämpfte zeitgenössische wie nachträgliche Ausdeutung des Einigungsgeschehens, das es gilt, in seinen historischen Bedingtheiten auszuleuchten – nicht zuletzt deshalb, weil vieles von dem bis heute nachwirkt.
By using a 60s workplace as its setting, Matthew Weiner’s Mad Men (2007-2015) does not merely provide insight into historical gender and sex relations in the workplace of the 60s. It also reflects current sex and gender relations in the workplace of 21st century America (e.g. the #MeToo Movement). As Sara Rogers, leaning on Horace Newcomb and Paul Hirsch, argues, tv shows’ strength lies in their raising questions, rather than answering them. This is precisely what Mad Men, with its representation of 1960s sex and gender dynamics does. In the following blogpost I will show that Weiner’s hit show is very aware of – among others – Helen Gurley Brown’s influence on the American workplace of the 60s and that it uses its nostalgic effect for reflecting contemporary sex and gender relations in the workplace.
In beiden deutschen Teilstaaten gehörten die Rentenversicherungen zu den ersten Nutzern von Computern. Bereits seit Mitte der 1950er Jahre berechneten diese die Altersruhegelder im Westen, zehn Jahre später auch in der DDR. Die digitale Datenverarbeitung versprach große Rationalisierungs- und Beschleunigungseffekte. Gleichwohl führten die verschiedenen Staats- und Versicherungsformen zu einer unterschiedlichen Nutzung von Computern.
Die Studie von Thomas Kasper zeigt, unter welchen Bedingungen sich die elektronische Datenverarbeitung in der Sozialverwaltung durchsetzen konnte. Sie verdeutlicht, welchen bisher unbekannten Einfluss sie auf sozialpolitische Entscheidungen sowie auf die Arbeitsverhältnisse und den Datenschutz in beiden deutschen Teilstaaten hatte. Nach der Wiedervereinigung ließ nur die gemeinsame Nutzung der vorhandenen digitalen Strukturen die Zusammenführung beider Sozialsysteme gelingen.
Mit seinen Aufnahmen dokumentierte der Istanbuler Fotograf Ergun Çağatay (1937 – 2018) den Alltag zahlreicher türkeistämmiger Familien in fünf deutschen Städten im Frühjahr 1990. Çağatays Portraits aus Hamburg, Köln, Werl, Berlin und Duisburg bilden die bis heute umfangreichste Bildreportage zur türkeistämmigen Einwanderung in Deutschland.
Noch bis zum 10. April 2023 sind diese Fotografien im Rahmen der Ausstellung „Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990. Fotografien von Ergun Çağatay“ im Museum Europäischer Kulturen (MEK) in Berlin zu sehen. Vor der Station in Berlin wurde die Ausstellung in unterschiedlichen Formaten in Ankara, Çanakkale, Essen, Hamburg, Istanbul, İzmir und Zonguldak gezeigt.
Zum Kurator:innen-Team der Ausstellung gehören Stefanie Grebe, Meltem Kücükyilmaz, Alexandra Nocke und Peter Stepan. Für visual-history.de führte Historikerin Janaina Ferreira dos Santos am 17. Dezember 2022 im MEK ein Gespräch mit Meltem Kücükyilmaz.
During the first five-year plan, the Soviet state turned to an unusual source to cope with the challenge of factory-induced deafness and disability: the deaf community. From 1930 to 1937, deaf activists, alongside specialist doctors, organised a yearly, three-day event known as Beregi slukh! (Take Care of Your Hearing!) to propagandise the prevention of deafness. During these years, more than 46,600 lectures were held in venues across the Soviet Union and 7,900,000 brochures, leaflets and posters printed. While the event reflected the Soviet belief that disability was a relic of the ›backward‹ past that would be eliminated as communism approached, the deaf activists involved in these events used them to make the alternative case for their own identity as a legitimate part of the Soviet body politic. By foregrounding their labour capacities and demonstrating aspects of deaf cultural practices (including sign language) to a hearing audience, Beregi slukh! became a powerful means to advocate for the centrality of the deaf community to Soviet visions of self and society.
Dieser Aufsatz erklärt die enorme Resonanz von Günter Wallraffs Bestseller »Ganz unten« (Erstausgabe 1985) mit den emotionalen Bedürfnissen und der soziokulturellen Verfasstheit der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft. Das Buch artikulierte soziale Abstiegsängste während einer wirtschaftlichen Strukturkrise mit hoher Arbeitslosigkeit. Es präsentierte eine binäre Weltsicht, die die expressive Emotionskultur der 1980er-Jahre reflektierte. Die nahezu apokalyptische Darstellung der westdeutschen Industriegesellschaft und ihres menschenverachtenden Umgangs mit migrantischen (Leih-)Arbeitern stand im Einklang mit der Weltsicht eines wachsenden grün-alternativen Milieus. Im Gegensatz zur populären Erinnerung war das Buch jedoch kein Wendepunkt in der öffentlichen Repräsentation der türkischen »Gastarbeiter«, für deren Erfahrungen Wallraff nach seiner Undercover-Recherche als »Ali« zu sprechen schien. Vielmehr verdeutlichte »Ganz unten« massive Defizite im Umgang mit Differenz in der bundesrepublikanischen Gesellschaft der 1980er-Jahre, gerade auch auf der Linken. Nicht Wallraffs Buch, sondern die damalige, bisher vernachlässigte deutsch-türkische Kritik daran markiert eine historisch signifikante antirassistische Traditionslinie, die bis in die Gegenwart reicht.
Wie hängen Arbeit und Geschlecht, Erfahrungen marginalisierter Männlichkeit und die Möglichkeiten des Zugangs zu (Erwerbs-)Arbeit zusammen? Dies war die Ausgangsfrage des vorliegenden Gesprächs. Ausdrücklich wollten wir dabei eine relationale Perspektive einnehmen, weil – je nach Kontext differierende – Vorstellungen und Praktiken von Männlichkeit nicht ohne Vorstellungen von Weiblichkeit zu verstehen sind und hegemoniale Männlichkeit auf marginalisierte Männlichkeiten verweist. Das Interesse am Thema erwuchs aus einem Forschungsprojekt zu »Maskulinität(en)«, das Cornelia Brink (Neuere und Neueste Geschichte, Historische Anthropologie) und Olmo Gölz (Islamwissenschaft, Iranistik) gemeinsam mit Kolleg*innen aus weiteren Disziplinen seit 2020 als Teilprojektleiter*innen im Sonderforschungsbereich 948 »Helden – Heroisierungen – Heroismen. Transformationen und Konjunkturen von der Antike bis zur Moderne« an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bearbeiten. Der Forschungsgruppe geht es darum, Heldentum und Männlichkeiten zusammenzudenken und das Heroische als – möglicherweise – zugangsregulierendes Paradigma für Positionen in Geschlechterordnungen zu problematisieren. In einer interdisziplinär besetzten Diskussionsrunde und mit dem Blick »von außen«, d.h. jenseits der Heldenforschung, sollte die Frage nach Zugang und Ausschluss, den damit verbundenen Wahrnehmungen, Handlungsoptionen und (vermeintlichen) Ansprüchen für den Zusammenhang von Männlichkeit und Arbeit erweitert werden. Neben ihrer jeweiligen fachlichen Spezialisierung aus Medizin/Psychoanalyse, Geschichte und Soziologie brachten die Beteiligten durch ihre nicht nur berufliche Sozialisation in Iran und in der Schweiz, in der (»alten« und »neuen«) Bundesrepublik und den USA sowie in der DDR und im vereinten Deutschland ganz unterschiedliche lebensgeschichtliche Zugänge ein. In einer Zeit, in der interdisziplinäre Zusammenarbeit sich als Versprechen ganz selbstverständlich in Anträgen findet, die geistes- und sozialwissenschaftliche Praxis dagegen weiter oft von wechselseitigen Abgrenzungen der einzelnen Fächer bestimmt zu sein scheint, sehen wir einen wichtigen Ertrag des Gesprächs in der Annäherung an einen gemeinsamen Problemzusammenhang aus verschiedenen fachlichen Perspektiven.
Obdachlosen Männern wird aufgrund ihrer prekären Lebenssituation häufig eine »marginalisierte Männlichkeit« (Raewyn Connell) zugeschrieben. Welche Männlichkeitsformen diese soziale Gruppe von sich selbst öffentlich präsentierte, ist bisher aber noch unerforscht. Anhand des »Berber-Briefes« – einer von obdachlosen Männern selbst verfassten und vertriebenen Zeitung – und deutschen Straßenmagazinen werden Männlichkeitsentwürfe von Wohnungslosen oder ehemals Wohnungslosen analysiert. Dabei fällt auf: »Berber-Brief«-Autoren der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre präsentierten eine selbstbewusste »Protestmännlichkeit«, Straßenmagazinverkäufer der 2010er-Jahre eher eine von Dankbarkeit und Arbeitsethos geprägte »komplizenhafte Männlichkeit«. Wie lässt sich dieser Wandel erklären? Die verschiedenen Medienformate, deren Professionalisierung und Kommerzialisierung waren dabei wichtig, aber auch die Bereitschaft von Obdachlosen, sich bestimmten Verhaltenserwartungen partiell anzupassen – als Folge einer Sozialpädagogisierung und Individualisierung gesellschaftlicher Problemlagen. Der Aufsatz trägt zu einer Geschlechter- und Zeitgeschichte der Armut bei, die auf die Betroffenen als Akteure fokussiert.
Homeless men are often ascribed a ›marginalized masculinity‹ (Raewyn Connell) due to their precarious existence, yet the forms of masculinity this social group has publicly presented to others have remained unexplored. The article analyses the masculinities of homeless or formerly homeless people on the basis of the ›Berber-Brief‹ – a newspaper written and distributed by homeless men themselves – and German street magazines. It is striking that the ›Berber-Brief‹ authors of the late 1980s and early 1990s projected a self-confident ›protest masculinity‹, while the street magazine sellers of the 2010s tended to display a ›complicit masculinity‹ characterised by gratitude and a strong work ethic. How can this shift be explained? The various media formats and their professionalisation and commercialisation were important here, as was the willingness of homeless people to partially adapt to certain behavioural expectations – as a result of a social pedagogisation and individualisation of social problems. The article contributes to a gender and contemporary history of poverty that focuses on the people affected as actors.
While British coal miners are often cast in the collective memory as traditionalists, the article reveals a more complex conception of identity. During the 1970s and 1980s, the National Union of Mineworkers (NUM) combined ideas of heroic masculinity with support for the workplace rights of women and ethnic minorities. ›Muscular masculinity‹ was used as a resource to further the opportunities of disadvantaged groups and to defend the miners’ own interests, as is demonstrated with reference to the ›Grunwick‹ dispute of 1976–78 and the great miners’ strike of 1984/85. The miners’ prioritising of muscular masculinity did not go uncontested at the time. Yet it was not until the events of 1984/85 that the NUM’s cult of masculinity came to be seen as a cause of the miners’ defeat and a problem for the British Left in general. Following a famous dictum by E.P. Thompson, the article argues that historical conceptions of masculinity should be measured by the standards of the time rather than the expectations of our present.
Im Zentrum des Beitrags steht die Sozialfigur des britischen Bergmanns in den 1970er- und 1980er-Jahren. Während der Bergarbeiter im kollektiven Gedächtnis der Gegenwart gern als traditionsverhaftet dargestellt wird, rekonstruiert der Aufsatz einen vielschichtigeren Identitätsentwurf, der eine heroisierte Form von Männlichkeit mit dem Einsatz für die Rechte von Frauen und ethnischen Minderheiten am Arbeitsplatz verband. »Muskuläre Männlichkeit« galt der National Union of Mineworkers als Machtressource, die sowohl zur Ausweitung der Lebenschancen anderer als auch zur Verteidigung eigener Interessen eingesetzt werden konnte, wie am Beispiel des »Grunwick«-Arbeitskampfes der Jahre 1976–1978 sowie des großen Bergarbeiterstreiks von 1984/85 dargelegt wird. Bereits zeitgenössisch blieb die gewerkschaftliche Betonung heroisierter Männlichkeit nicht unwidersprochen. Erst infolge des verlorenen Streiks 1984/85 setzte sich allerdings eine Sicht durch, die diese Form von Männlichkeit mitverantwortlich machte für das Scheitern der Gewerkschaft und die Krise der britischen Linken in den 1980er-Jahren. Im Anschluss an ein berühmtes Diktum E.P. Thompsons plädiert der Beitrag dafür, historische Männlichkeitsentwürfe stärker an den Maßstäben der Zeit als an den Erwartungen unserer Gegenwart zu messen.
By analysing oral history interviews with industrial workers in Poland, this article adds some nuance to the study of post-industrial and post-socialist nostalgia. It presents diverse vernacular memories of the post-1989 systemic change from state socialism to neoliberal capitalism, and shows that nostalgia for an industrial ›golden age‹, although significant, is not the only way of making sense of this change. Rather, a distinctive feature of vernacular memory is the ambiguity about both socialism and capitalism. Recognising the variety of memories, the article underlines the critical potential of nostalgic currents for highlighting what is felt to be wrong with contemporary work culture. The article also differentiates between the vernacular memories of industrial communities recorded in oral history and institutionalised political memories in order to stress that the critical potential of nostalgic memories has been largely absent in the latter. In Poland, nostalgia for industrial life has been given little opportunity to become a reflective and critically useful mechanism to protect values that remain relevant in the present, such as the importance of sociability and agency in the workplace.
Vom Nutzen und Nachteil der Nostalgie. Das Kulturerbe der Deindustrialisierung im globalen Vergleich
(2021)
Der Aufsatz entwickelt eine Typologie von Deindustrialisierungsregimen in globaler Perspektive und setzt diese in Beziehung zu drei verschiedenen Arten des Erinnerns an Industrialisierung und Deindustrialisierung: antagonistisches, kosmopolitisches und agonales Erinnern. In welcher Weise und in welchem Maße waren und sind nostalgische Formen des Erinnerns in den unterschiedlichen Deindustrialisierungsregimen präsent? Anknüpfend an bisherige Forschungen wird dafür plädiert, Nostalgie nicht bloß als rückwärtsgewandtes, antiquarisches Sentiment zu betrachten, sondern ihr Potential für die Konstruktion von Zukunft zu erkennen. Zugleich wird versucht, die Theorie des agonalen Erinnerns, wie sie von der Historikerin Anna Cento Bull und dem Literaturwissenschaftler Hans Lauge Hansen entwickelt wurde, für die Deindustrialisierungsforschung fruchtbar zu machen. Der Aufsatz ist ein Diskussionsangebot, wie man die Erinnerung an das Industriezeitalter für unterschiedliche Weltregionen verflechtungsgeschichtlich und vergleichend untersuchen kann – sei es in Südwales, im Ruhrgebiet oder im Osten Chinas.
Gewerkschaftsgeschichte
(2021)
Gewerkschaften sind bis heute als Selbstorganisationen und Interessenvertretungen der Arbeiterschaft ein wichtiger Teil des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Sie waren vor allem im 19. und 20. Jahrhundert bedeutende historische Akteure der Vorgeschichte der Gegenwart. Knud Andresen bietet in seinem Artikel einen Überblick zur Entwicklung der Gewerkschaften mit Schwerpunkt auf Deutschland, besonders der Bundesrepublik ab 1945, aber auch mit Seitenblicken auf die Gewerkschaftsgeschichte der DDR, und der internationalen Verbünde. Verschiedene sozialwissenschaftliche und historiografische Deutungen werden dargestellt und damit das Forschungsfeld skizziert. Auch nach systematischen Potenzialen der zeitgeschichtlichen Gewerkschaftsgeschichte wird gefragt.
Das Thema Vereinbarkeit von Mutterschaft und wissenschaftlicher Karriere wird seit einigen Jahren sehr intensiv diskutiert. Die Publikation von Sarah Czerney, Silke Martin und Lena Eckert geht einen neuen Weg, in dem nicht nur auf das Thema Elternschaft rekurriert, sondern auf ein allgemeines, in der Gesellschaft fest verankertes Bild der Frau als potenzielle Mutter. Es werden Erfahrungen von Wissenschaftler:innen aus verschiedenen Fachgebieten in unterschiedlichen Funktionen gesammelt um ein diverses Bild der Problematik zu zeichnen. Die Unvereinbarkeit sei, so die Herausgeber:innen, den „symbolischen, psychischen, historischen, ökonomischen und politischen Koordinaten geschuldet“. In dieser thematischen Fokussierung wird nichts beschönigt, es werden keine Held:innengeschichten erzählt. Die Publikation ist vielmehr eine Bestandanalyse, die zu dem Schluss kommt: es braucht nicht nur eine Schärfung des Diskurses, sondern konsequente Veränderungen der wissenschaftlichen Praxis.
Die Redaktion lud Doktorandinnen des Zentrums für Zeithistorische Forschung (Potsdam) dazu ein, über ihre Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb zu sprechen. Anna Junge, Anna Katharina Laschke, Caroline Peters, Florentine Schmidtmann und Henrike Voigtländer erklärten sich dazu bereit und verabredeten sich zu einem Gespräch. Ihre Diskussion fassten sie für Zeitgeschichte|online zusammen.
„Mikätzchen“ schnurrten in den sechziger Jahren hundertfach durch die Klassenzimmer Nordrhein-Westfalens. Diese eilig zu Volksschullehrerinnen vorbereiteten Hausfrauen waren in den achtziger Jahren allerdings längst in Vergessenheit geraten, als ihre mittlerweile wesentlich besser qualifizierten Nachfolgerinnen als unbarmherzige „Doppelverdienerinnen“ durch Presse und Politik spukten. Was hatte sich innerhalb von nur zwei Dekaden verändert? Was war gleichgeblieben? Dass insbesondere Frauen betroffen vom Arbeitsplatzabbau sind, ist nicht überraschend. Aber wie verhielt es sich in einem akademischen Beruf, in dem die Beschäftigten ihre Stellen auf Lebenszeit innehatten? Welche Inklusions- und Exklusionsprozesse können in dem mittlerweile gemeinhin als „Frauenberuf“ etikettierten Lehrberuf rekonstruiert werden?
Das Zeitalter des Kolonialismus liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück, und noch immer sind „westliche Gesellschaften“ gegenüber den ehemaligen Kolonien nicht frei von Missionierung und Überheblichkeit. Im Zuge der Jahrhunderte andauernden Kolonialpolitik wurden religiöse politische und sprachliche Argumente bemüht, um die europäische Herrschaft über große Teile der Welt zu rechtfertigen. Konzeptuelle Metaphern, mit denen die Kolonisierenden ihre Überlegenheit und die Andersartigkeit der Kolonisierten konstruierten, ziehen sich wie ein roter Faden durch den kolonialen Diskurs, beispielsweise als Gegensatz zwischen Erwachsenen–Kindern, Eltern–Kindern oder Lehrenden– Lernenden. Noch 1922 schrieb Frederick Lugard in seinem Dual Mandate in British Tropical Africa über „den Afrikaner“: ‚He is an apt pupil‘.
Um dieses Lehr-Lern-Verständnis umzukehren, fand unter dem Namen Learning from Africa: Equal opportunities for women in academia vom 28.-30. Oktober 2019 eine Konferenz an der Universität Potsdam statt. Dazu waren Forscherinnen aus Südafrika, Ghana und Nigeria eingeladen, um die Karrieremöglichkeiten von Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ergänzt wurde das Vortragsprogramm von lokalen Expertinnen aus den Bereichen Nachwuchs-/Talentförderung und Gleichstellung.
Eine Betrachtung von Berufungen unter der Kategorie Geschlecht eignet sich in besonderem Masse dazu, gleichsam wie in einem Vergrösserungsspiegel, die soziale Bedingtheit von Berufungen aufzuzeigen. Diese werden bis heute von den an Berufungsverfahren Beteiligten wenig oder gar nicht reflektiert, besteht doch die unhinterfragte illusio[1] des akademischen Feldes darin, nach dem vermeintlich harten Kriterium der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit ›die besten Köpfe‹ zu berufen. Bislang gibt es für das 19. und 20. Jahrhundert, d.h. die Phase der sogenannten modernen Universität, keine historische, quellenbasierte Untersuchung zur inhaltlichen Ausgestaltung und zum Wandel von Berufungskriterien. Bisher ist auch das Verhältnis von Berufung und Geschlecht in historischer Längsschnittperspektive nicht systematisch untersucht worden.
Der folgende Beitrag erschien erstmals im Jahr 2012 in der Publikation „Professorinnen und Professoren gewinnen. Zur Geschichte des Berufungswesens an den Universitäten Mitteleuropas“, die von Christian Hesse und Rainer Christoph Schwinges herausgegeben wurde. Mit freundlicher Erlaubnis der Autorin Sylvia Paletschek veröffentlicht zeitgeschichte|online die Einleitung des Aufsatzes. Eine vollständige Version findet sich auf dem freien Dokumentenserver FreiDoks plus, ein Angebot der Universitätsbibliothek der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und im Material zu diesem Beitrag.
Als Studentinnen an der Universität Hamburg für das erste Seminar zu einem frauengeschichtlichen Thema stritten, das dann 1976 als zweisemestrige Übung zum Thema „Frauen im Nationalsozialismus“ stattfand, gab es fast keine historischen Darstellungen und Quelleneditionen zum Thema. Die Dozentin, die sie für das Vorhaben gewinnen konnten, war Hochschulassistentin in Mittelalterlicher Geschichte, dennoch waren der Enthusiasmus und die Hoffnungen groß, trotz des massiven Widerstands von Seiten männlicher Professoren. Zu diesem Zeitpunkt gab es am Historischen Seminar der Universität erst eine Professorin. Die Studentinnen – zu denen auch ich gehörte – hofften, dass der verschwindend niedrige Frauenanteil an den C2, C3 und C4 Professuren schnell ansteigen und sich damit auch die Inhalte von Forschung und Lehre im Fach Geschichte grundlegend ändern würden. [...] Vierzig Jahre später sind solche Geschichten und Zahlen Vergangenheit. Heute – so ist immer wieder zu hören – seien wir auf einem guten Weg zur Gleichberechtigung von Frauen in der Geschichtswissenschaft, und auch die Frauen- und Geschlechtergeschichte sei doch allgemein anerkannt. Dafür würde schon die Gender-Mainstream-Politik mit Maßnahmen wie dem Mentoring-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen und dem Professorinnen-Förderprogramm des Bundesforschungsministeriums sorgen. Diese Annahme trifft nur bedingt zu, wie der jüngste Report zum „Personal an Hochschulen“ des Statistischen Bundesamtes zeigt.
»Du sollst Solidarität mit den um nationale Befreiung kämpfenden und den ihre nationale Unabhängigkeit verteidigenden Völkern üben.« So lautet das letzte der 1958 von Walter Ulbricht verkündeten »Zehn Gebote der sozialistischen Moral und Ethik« (auch: »Zehn Gebote für den neuen sozialistischen Menschen«), die von 1963 bis 1976 Teil des SED-Parteiprogramms waren.1 Die sozialistische Variante der christlichen Zehn Gebote findet sich häufig auf der ersten Seite von »Brigadetagebüchern«, die Beschäftigtenkollektive in der DDR und in anderen staatssozialistischen Ländern verfassten. Über die Grenzen der DDR hinaus stellten auch »Freundschaftsbrigaden« der Freien Deutschen Jugend (FDJ) solche Brigadetagebücher zusammen, um ihre Aufenthalte in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zu dokumentieren. Diese Quellen geben einen wertvollen Einblick in die sozialistische Globalisierung und deren Alltagspraktiken.
Ab Mitte der 1960er-Jahre avancierte Weiterbildung auf internationaler Ebene zum dreifachen Schlüssel gesellschaftlicher Zielvorstellungen: Sie versprach ökonomische Prosperität, soziale Gerechtigkeit und individuelle Selbstverwirklichung. Durch diesen umfassenden Anspruch lösten sich die Grenzen zwischen beruflicher und politischer Bildung auch in der Bundesrepublik auf. Weiterbildung wurde hier zum Kampfplatz divergierender politischer Ordnungsmodelle, deren Legitimität unter dem Eindruck der Proteste um 1968 zwischen den Vertretern von Arbeit und Kapital besonders vehement ausgefochten wurde. Der Beitrag analysiert, wie Unternehmen und ihre Interessenverbände bewusst in die politische Bildung einstiegen, um sie im Sinne der eigenen Gesellschaftsideale zu einem wirksamen Instrument der Personalentwicklung zu machen. Im Zentrum stand dabei die Einübung politischer Kommunikation als eine Form der Selbstermächtigung gegen linke Herausforderer. Am Beispiel von Marxismus- und Dialektik-Seminaren für Führungskräfte aus Unternehmen wird gezeigt, wie diese politische Schulung auf eine Stärkung der Gruppenidentität und eine Transformation individueller Selbstverhältnisse zielte. Komplementär dazu versuchten die Arbeitgeber, die Weiterbildung für Betriebsräte zu entpolitisieren und sie dem Einfluss der Gewerkschaften zu entziehen.