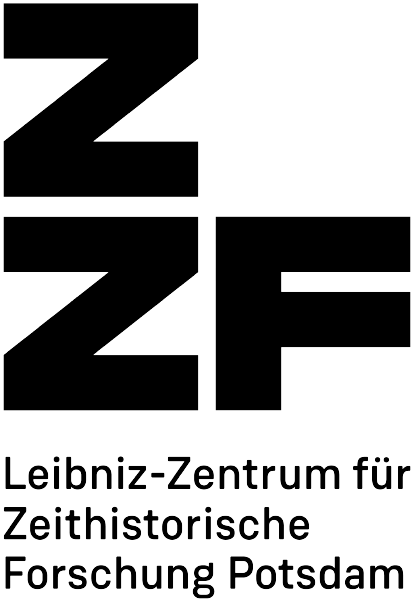Weder Ost noch West. Ein Themenschwerpunkt über die schwierige Geschichte der Transformation Ostdeutschlands
Refine
Year of publication
- 2019 (25)
Document Type
- Online Publication (25)
Language
- German (25)
Has Fulltext
- yes (25)
Es ist etwas in Bewegung geraten in der ohnehin komplizierten deutsch-deutschen Erinnerungslandschaft. Nach dreißig Jahren wandeln sich die Rückblicke auf die jüngste Vergangenheit. Im Fokus steht dabei die Zeitenwende von 1989/90, die Deutschland und Europa wieder intensiv umtreibt. Eine neue Welle von Populismen und Nationalismen spült scheinbar vergessene, verdrängte oder überwunden geglaubte Fragen zu den materiellen wie ideellen Erbschaften von Staats- und Postsozialismus erneut an die Oberflächen. Als zuletzt auch die sonst in dieser Hinsicht so schweigsame Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview gegenwärtig – angesichts bisweilen heftiger publizistischer Debatten – ein ostdeutsches „1968“ aufdämmern sah, wurde offensichtlich: Vormals festgefügte Meister- beziehungsweise Siegererzählungen (West?) und hierauf bezogene Gegen- beziehungsweise Opfererzählungen (Ost?) werden brüchig und verlieren an Überzeugungs- und Bindekraft.Politische, generationelle, wissenschaftliche und kommunikativ-technologische Dynamiken überschneiden sich in einem nur schwer überschaubaren Geflecht aus vielfältigen Interessen, Meinungen und Emotionen. Und mittendrin: eine gerade erst dieses neue Feld empirisch für sich entdeckende Zeitgeschichtsforschung.
Die Friedliche Revolution und die folgende Systemtransformation wurden von den Ostdeutschen als tiefer biographischer Einschnitt erlebt. Weite Teile ihrer Lebenswelt veränderten sich, einstige Sicherheiten waren auf einmal nicht mehr sicher. Dieser revolutionäre Wandlungsprozess wurde ganz unterschiedlich erlebt und gedeutet. Heute prägen die damaligen Erfahrungen den Rückblick auf diese Zeit. Es besteht ein Erinnerungskonflikt zwischen einem Revolutionsgedächtnis, das die demokratischen Errungenschaften hochhält, und einem Verlustgedächtnis, das den Umbruch als Zeit der Verunsicherung und enttäuschten Erwartungen abgespeichert hat und bis heute eine skeptische Haltung zur neuen politischen Ordnung einnimmt. Eng verklammert ist die jeweilige Deutung zudem mit unterschiedlichen Geschichtsbildern von der SED-Diktatur, deren wichtigste Quelle heute die Familie ist. Schule und Gedenkstätten spielen bei der Ausprägung von Geschichtsbildern hingegen eine deutlich nachgeordnete Rolle. Auch die jeweiligen Diktaturerfahrungen prägen also die Sicht auf die Transformation.
Geschlechterverhältnisse innerhalb der sozialwissenschaftlichen Transformationsforschung eher eine marginale Rolle. Es war vor allem die interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, die die Auswirkungen des Systemwechsels in der früheren DDR in den Blick nahm. Die Fülle der bis in die frühen 2000er Jahre entstandenen Forschungen trug Karin Aleksander in ihrer Bibliographie „Frauen und Geschlechterverhältnisse in der DDR und in den neuen Bundesländern“ zusammen.
Der Weg zur Friedlichen Revolution in der DDR bis in die ersten Jahre im vereinigten Deutschland ist einer der wichtigsten und weitreichendsten Prozesse der deutschen Zeitgeschichte. Gerade oder vielleicht, weil die Einheit heute eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint und bereits eine Generation herangewachsen ist, die nur das geeinte Deutschland erlebt hat, kommen der Forschung und der Vermittlung der Transformationsgeschichte große Bedeutung zu. Nicht zuletzt erhalten die Forschungsergebnisse zur Transformationsgeschichte auch deshalb viel Aufmerksamkeit, weil das Gefühl der Ungleichheit noch immer vorhanden ist, trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs vieler ostdeutscher Regionen. Diese Wahrnehmung ist keineswegs unberechtigt: So sind etwa Ostdeutsche in Führungspositionen von Wirtschaft und Wissenschaft weiterhin unterrepräsentiert.
Margaret Thatcher soll einmal gesagt haben, dass die Menschen alle dreißig Jahre etwas radikal Neues wollen. In dieser Lesart wäre es folgerichtig, dreißig Jahre nach dem letzten großen historischen Einschnitt auch Deutungen der Geschichte neu zu kontextualisieren. Nicht ohne Grund erleben wir aktuell, dass die Ereignisse der Friedlichen Revolution, der Deutschen Einheit und der ersten Jahre nach der Wiedervereinigung auch in den Fokus historischer Betrachtungen geraten. Der Abstand von einer Generation bedeutet, dass wir nunmehr allmählich von der Perspektive der Erinnerung in die Perspektive des Historisierens übertreten.
Wagen wir einmal einen Blick zurück: Auch der Umgang mit der NS-Geschichte verlief in verschiedenen Etappen. Es brauchte über zehn Jahre, bis es etwa mit Filmen wie „Rosen für den Staatsanwalt“ erste Formen der Auseinandersetzung gab. Die Auschwitz-Prozesse, der Umgang mit der Erstausstrahlung der Reihe „Holocaust“ oder auch die Frage nach dem Umgang mit dem 8. Mai – all dies waren Episoden in einem jahrzehntelangen Ringen um den Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Was allgemein als Errungenschaft von „68“ gewertet wird, nämlich ein Wandel im Umgang mit der Vergangenheit, um daraus auch ein neues Selbstverständnis für die Gegenwart abzuleiten, war in Wirklichkeit ein mühsamer Prozess, der bereits früher begann und länger als einen Protestsommer andauerte. Die Debatten um die Weizsäcker-Rede zum 8. Mai 1985 oder der Historikerstreit der 1980er Jahre zeigten, wie hart selbst fast zwei Generationen nach Kriegsende noch um ein Geschichtsbild gerungen wurde. Die Auseinandersetzung über das Selbstbild, den Umgang mit Geschichte und den Folgerungen daraus sind eine jahrzehntelange Arbeit ist, die mit dem Abstand einer Generation eher beginnt, als das sie endet.
Aufarbeitung von Geschichte ist anders als die geschichtswissenschaftliche Analyse ein politischer Vorgang, eine Angelegenheit der Zivilgesellschaft. Die DDR-Aufarbeitung war mit dem Grundsatz angetreten, die Demokratie im Osten zu befördern. Manche Aufarbeiter*innen verkünden sogar etwas zu vollmundig, je besser man Diktatur begreife, umso besser könne man Demokratie gestalten. Demokratie ist ein Projekt, das keiner Negativfolie bedarf.
Aufarbeitung generell ist wichtig, keine Frage. Aber wie wichtig ist sie wirklich? Wer sollte das messen, einschätzen? Wen erreicht Aufarbeitung und vor allem, wen nicht? Man sollte sie nicht überschätzen, so wie man das Gewicht einzelner dabei nicht überschätzen sollte. Es machen weder große Männer allein Geschichte noch schlanke Menschen allein Geschichtsaufarbeitung. Beide Gruppen glauben das allerdings gern.
In der DDR-Aufarbeitungslandschaft haben wir den merkwürdigen Umstand zu beobachten, dass in vielen Institutionen Personen Entscheidungen fällen, den Ton vorgeben, Verantwortung tragen, die dafür meist „nur“ durch ihre Biographie, nicht aber wegen einer professionellen Ausbildung in Museumsdidaktik, Geschichtspädagogik, Geschichts- oder Politikwissenschaften qualifiziert sind. Vor allem in den 1990er Jahren war es von hoher Bedeutung, dass Oppositionelle und Opfer der SED-Diktatur den kommunistischen und postkommunistischen Geschichtsmärchen ihre lebensgeschichtliche Wucht entgegenhielten. Aber die Revolution ist längst Geschichte. Die Kinder sind nicht entlassen worden, sondern eigentlich im Rentenalter.
Die Friedliche Revolution des Jahres 1989 rückte die Geschichte der SED-Diktatur und der deutschen Teilung auf die Agenda der bald darauf gesamtdeutschen Erinnerungskultur. Dreißig Jahre später ist die Geschichte der kommunistischen Diktatur selbstverständliches Thema von Museen und Gedenkstätten, Lehrplänen, der Belletristik und TV-Produktionen. Einschlägige Jahrestage werden gleichermaßen im Osten wie im Westen Deutschlands begangen. Wissenschaftliche Studien füllen ganze Bibliotheken. Zeitweilig hieß es sogar, die DDR sei überforscht — eine These, die mehr über den Überdruss ihrer Urhebern als über den Forschungsgegenstand aussagte. Welches Forschungspotential im Thema steckt, zeigt der 2016 erschienene Sammelband „Die DDR als Chance“ auf.
Schwarze Löcher
(2019)
Im Jahr 1993 oder 1994 zeigte mir mein Vater ein wackeliges Video. Er und seine ehemaligen Arbeitskollegen hatten gemeinsam ein Schwein aufgezogen, und nun sollte jeder seinen Anteil bekommen. Im Video sah man, wie die Sau über den Hof getrieben wird, dann bindet sie jemand am Hinterlauf fest. Das Tier wird „Wessi“ getauft. Die Männer johlen, das Bier fließt. Dann wird Wessi mit einem Bolzenschussgerät niedergestreckt, das Schwein zappelt am Boden, jemand sticht in die Halsschlagader, das Blut strömt in einen bereitgestellten Bottich. Mein Vater wirft sich auf die Sau, um sie zu fixieren. Es ist der 7. Oktober, das Datum des ehemaligen „Tags der Republik“ der DDR. Das Schwein wird mit kochendem Wasser übergossen und abgeschabt. Wessi wird zu Wurst verarbeitet.
In der DDR entwickelte sich eine staatssozialistische „Geltungskunst“, die man als „DDR-Kunst“ oder „Kunst der DDR“ bezeichnen könnte im Unterschied zu den vielfältigeren Formen einer „Kunst in der DDR“. Diese mit dem politischen Projekt eng verbundene Kunst sollte von allen historischen wie zeitgenössischen Moderne-Anhaftungen bereinigt werden, was in der Komplexität künstlerischer Produktions- und Rezeptionsweisen allerdings nur ansatzweise gelang. Auch wenn der Wirkungsgrad jener an einer didaktischen Symbolisierung der sozialistischen Leitideen beteiligten Künste die Erwartungen der Machthaber nur unzureichend erfüllte, so blieb die Kunst des „Sozialistischen Realismus“ doch innen- wie außenpolitisch ein unverzichtbares Instrument der Herrschaftslegitimation. Die SED-Funktionäre versuchten, den „Sozialistischen Realismus“ als Widerpart zum westlichen Modell einer kosmopolitischen „Weltkunst“ in Stellung zu bringen. Somit wurde für die offizialkulturelle Kunstproduktion der DDR anstatt des intrinsischen Moderne-Konfliktes zwischen Autonomie und institutionalisierter Kunst von Anbeginn eine andere Gegensatzspannung prägend – die zwischen Ost und West.
Als vor gut zehn Jahren meine Studie über „Das Schicksal der DDR-Verlage“ im Prozess der deutschen Vereinigung erschien, gab es große mediale Aufregung über die Resultate. Die Zahlen waren tatsächlich erschütternd: Von den ehemals 78 staatlich lizenzierten Verlagen der DDR existierte 2006 in eigenständiger Form nur noch ein Dutzend, was etwa 15% entsprach. Nach Wirtschaftskraft betrachtet, waren die ostdeutschen Verlage inzwischen fast vollständig zu vernachlässigen: Am Gesamtumsatz der deutschen Buchbranche von damals 10,7 Mrd. € waren Firmen aus den neuen Bundesländern (ohne Berlin) 2006 nur noch mit 0,9 % beteiligt.
Das Erschrecken war nicht nur deshalb so groß, weil selbst die meisten Branchenteilnehmer einen gefühlt anderen Eindruck hatten, sondern weil die Verlagsbranche damit noch unter dem Ergebnis anderer Wirtschaftsbereiche Ostdeutschlands lag, denn nach Treuhandangaben sind dort insgesamt rund 20% der Betriebe erhalten geblieben.
Schaut man sich die Situation heute an, hat sich die Lage keineswegs verbessert. Zwar haben einige Verlage ihren Sitz nach Berlin verlagert und sind ein paar neugegründete Kleinstverlage hinzugekommen, doch die Gesamtlage hat sich kaum verbessert. An der Gesamttitelproduktion sind die ostdeutschen Bundesländer (ohne Berlin) nach wie vor nur mit insgesamt 5% beteiligt.