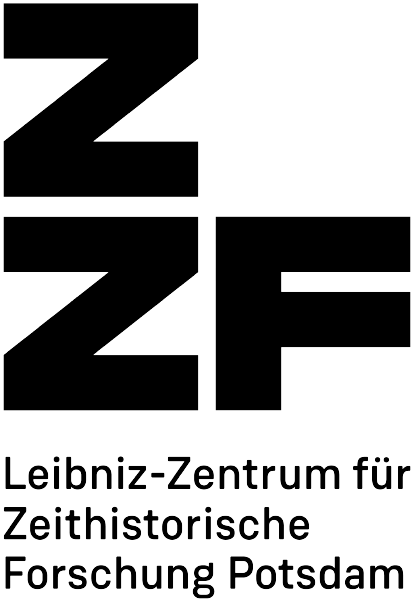3 / 2011 Internationale Ordnungen und neue Universalismen im 20. Jahrhundert
Politische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Krisen haben im beginnenden 21. Jahrhundert mehr denn je einen globalen Zuschnitt. Wenn die Weltwirtschaft ins Wanken gerät, wenn die internationale Staatengemeinschaft Maßnahmen gegen Hungerkatastrophen zu ergreifen versucht, wenn ein nuklearer Unfall (wie zuletzt im Frühjahr 2011 in Japan) weltweite Auswirkungen zeitigt oder wenn vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag die Verantwortlichen für die Massaker während des Jugoslawienkonflikts zur Rechenschaft gezogen werden – stets rückt die zwischenstaatliche, internationale Verständigung auf die Agenda. Auch die zeithistorische Forschung geht im frühen 21. Jahrhundert in wachsendem Maße über den Nationalstaat hinaus. Viele Arbeiten wählen einen europäischen Rahmen, erste Studien integrieren globalhistorische Bezüge. Eine gesteigerte Aufmerksamkeit kommt außerdem der lange Zeit von vielen nur wenig beachteten internationalen Sphäre zu. Der im Zeitalter der Extreme oft vergessene Internationalismus der Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg erlebt nun in der Historiographie ein breites Comeback.
Zu den Voraussetzungen der ‚alten‘ Diplomatie im 19. Jahrhundert gehörte eine gemeinsame, universal verständliche und verlässliche Formen- und Zeichensprache. Durch den Ersten Weltkrieg geriet die Diplomatie in eine Vertrauens- und Legitimationskrise, machte die Öffentlichkeit doch diplomatische Geheimverhandlungen für den Krieg verantwortlich. Der amerikanische Präsident Wilson forderte deshalb eine transparentere New Diplomacy. Das Austarieren von Geheimnis und (Medien-)Öffentlichkeit war nun Teil eines fundamentalen Wandlungsprozesses der ‚alten‘ Diplomatie. Mit kulturgeschichtlichem Zugriff geht der Aufsatz diesem Wandel nach. Untersucht werden die Pariser Friedenskonferenz von 1919 und speziell die beiden Begegnungen zwischen alliierter und deutscher Delegation bei der Übergabe und Unterzeichnung des Friedensvertrags in Versailles. Anhand dieser Szenen wird diskutiert, wie die gemeinsame Sprache zwischen Diplomaten verloren ging, welche langfristigen Faktoren dafür verantwortlich waren und wie der Krieg als Katalysator für tiefgreifende Veränderungen wirkte.
In Nürnberg formulierten die Alliierten 1945 erstmals das völkerrechtliche Prinzip, dass allgemeine Menschenrechte über nationalem Recht stehen. Damit wurde es möglich, staatlich sanktionierte Verbrechen zu ahnden – in diesem Fall die deutschen Verbrechen der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs. Seit den 1990er-Jahren haben diverse vergleichbare Prozesse stattgefunden, etwa zu den Ereignissen in Jugoslawien, Ruanda und Kambodscha. Dass das Führungspersonal eines Landes für Kriegsverbrechen und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ strafrechtlich belangt werden kann, war im 20. Jahrhundert stark umkämpft und ist bis heute nicht vollständig durchgesetzt. Der Aufsatz stellt die drei wichtigsten Etappen im Überblick dar: die Leipziger Prozesse nach dem Ersten Weltkrieg, die Prozesse von Nürnberg und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die Debatte um die Entstehung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Strittig war und ist vor allem, inwieweit auch Großmächte wie die USA bereit sind, universellen Menschenrechten und einer supranationalen Autorität gegenüber herkömmlichen nationalen Souveränitätsrechten einen Vorrang einzuräumen.
Im Sommer 1968 wurde der nigerianische Bürgerkrieg durch die Veröffentlichung von Fotos hungernder ‚Biafrakinder‘ zu einem internationalen Medienereignis. Dieser „Bildakt“ bezog einen Teil seiner Wirkungsmacht daraus, dass viele Zeitgenossen die aktuellen Bilder mit Fotografien assoziierten, die während der Befreiung der Konzentrationslager 1945 entstanden waren. Gestützt auf Medienberichte, Publikationen von Aktivisten und Archivmaterial stellt der Aufsatz die Grundzüge der internationalen politischen Kommunikation über Biafra dar und analysiert die Bezüge zur beginnenden kulturellen Erinnerung an den Holocaust. Die Einschreibung Biafras in die Ikonographie des Holocaust ließ eine neuartige Rhetorik des Holocaust-Vergleichs entstehen, durch die sowohl der nigerianische Bürgerkrieg wie auch die Verbrechen des Nationalsozialismus als Genozid sichtbar wurden. Diese Rhetorik erzeugte zwar für kurze Zeit viel Aufmerksamkeit, ging jedoch an der komplexen Realität des Konflikts vorbei. Als sich herausstellte, dass Biafra kein ‚neuer Holocaust‘ war, verloren die Bilder und die dazugehörige Rhetorik des Vergleichs ihre Wirkungsmacht.
Der Beitrag untersucht die Genese des Weltkultur- und Naturerbes der UNESCO im breiteren Kontext der Auseinandersetzungen um eine Neujustierung der internationalen Ordnung in den 1960er- und 1970er-Jahren. Die politischen Debatten um die Definition und Auswahl eines „Erbes der Menschheit“ dienen als analytische Sonde, um Veränderungen im Verhältnis von Partikularismus und Universalismus auszuloten. Anhand exemplarischer Konfliktfälle wird gezeigt, dass sich das Kultur- und Naturverständnis zwischen 1950 und 1980 gravierend veränderte, so dass zwei konkurrierende Rationalitäten in das Welterbeprogramm eingingen. Zudem werden die Erwartungen analysiert, die sich an die neue Governance-Institution und ihren weltweiten Anspruch richteten. Aus beiden Aspekten lässt sich die ungleiche regionale Verteilung der Welterbestätten und das bis heute unausgewogene Verhältnis von Kultur- und Naturerbestätten erklären. Der Aufsatz leistet damit auch einen Beitrag zur Historischen Semantik der Begriffe „Kultur“, „Natur“ und „Erbe“ im 20. Jahrhundert.
Die Internationale Geschichte verzeichnet gegenwärtig einen Boom – auch und besonders in der Zeitgeschichte. Hatte sich die zeithistorische Forschung in der Bundesrepublik seit ihren Anfängen, Hans Rothfels folgend, zwar „im internationalen Rahmen“ positioniert, so galt das vorrangige Interesse doch den großen Problemen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Entsprechend standen die deutsche Politik im Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik sowie der Nationalsozialismus und seine Folgen lange Zeit im Fokus. Später traten die Fragen der Zweistaatlichkeit sowie, nach 1989/90, umfassende Forschungen zur DDR-Geschichte und zu den beiden deutschen Staaten im Europa des Kalten Kriegs hinzu. Auch die Geschichte Europas hat in der zeithistorischen Forschung seit langem viel Aufmerksamkeit gefunden; verglichen mit Osteuropa genoss „der Westen“ hier allerdings oft einen Vorrang.
Im Jahr 2000 bemerkte Wilfried Loth, dass unter deutschen Historikerinnen und Historikern bislang selten systematisch über Internationale Geschichte nachgedacht worden sei. Bis heute ist mit dem Ansatz der Internationalen Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts eher eine Perspektive auf die „große Politik“ und auf die klassische Diplomatiegeschichte verbunden. Daran hat auch die inzwischen weitgehend etablierte Umbenennung der „Geschichte der internationalen Beziehungen“ in „Internationale Geschichte“ nur wenig geändert. Die Bände, die in der von Loth gemeinsam mit Eckart Conze, Anselm Doering-Manteuffel, Jost Dülffer und Jürgen Osterhammel seit 1996 herausgegebenen Reihe „Studien zur Internationalen Geschichte“ erschienen sind, öffneten sich zwar durchaus sozial- und kulturhistorischen Ansätzen. Das Repertoire der Globalgeschichtsschreibung ist hier aber noch nicht ausgeschöpft worden. Innovative globalhistorische Monographien, wie beispielsweise Sebastian Conrads Untersuchung zu „Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich“, liegen für die deutsche Zeitgeschichtsforschung noch nicht vor. Für das ‚lange 19. Jahrhundert‘ hat Conrad es verstanden, gerade das Deutsche Kaiserreich als nationales Gebilde in den Bezugsrahmen Internationaler Geschichte einzuspannen und hierbei den deutschen Nationalismus „auch als Produkt und Effekt von Interaktionen, Austausch und Zirkulation innerhalb einer zunehmend vernetzten Welt“ zu analysieren.
Having for a long time been an area of research mainly reserved for specialists in international relations and political scientists, the international organizations (IOs) that first emerged in the twentieth century’s pre-World War II decades have also attracted renewed interest of historians for the past several years. This development has its place in a movement of ‘globalization’ within the discipline, evident in both themes and practice. The nation, the region, and the village remain pertinent units for study, but the historian interested in global history approaches them in relation to other spaces, reflecting renewed attention to connections and forms of circulation traditionally neglected in specialized studies. As will be argued below, in their role as observation posts, the IOs and international associations here comprise an especially productive area of research, in effect opening access to work on complexly intermeshing ‘circulatory regimes’.
Gendered critiques by historians and feminist international relations scholars have been animating international history for a good thirty years by complicating the supposedly binary relationships between states and societies, private and public, and local and international that traditionally structured the discipline. In this essay we would like to ask what a sensitivity to gender might add to international histories that are shifting their focus away from intergovernmental relations towards a reassessment of internationalisms in the nineteenth and twentieth centuries through studies of transnational social movements, international organizations and norms, or practices of global governance. We are especially interested in how gender might contribute to a major emerging theme of international history today: the history of internationalism and international organizations as a struggle between competing or converging universalisms – ‘imperial and anticolonial, “Eastern” and “Western”, old and new’ – that sought to speak in the name of all humanity, rather than as the triumph of an international order imposed by the “West” on the rest.
Am 12. Oktober 1960 ergriff Nikita Sergeevič Chruščev in der UNO während der Rede des philippinischen Delegierten Lorenzo Sumolong seinen Schuh, schlug damit auf seinen Tisch und ereiferte sich: „Warum darf dieser Nichtsnutz, dieser Speichellecker, dieser Fatzke, dieser Imperialistenknecht und Dummkopf – warum darf dieser Lakai der amerikanischen Imperialisten hier Fragen behandeln, die nicht zur Sache gehören?“ Chruščev war zunächst mit seinem Auftritt sehr zufrieden – er berichtete seinem Berater Oleg Trojanovskij, er habe etwas verpasst; sie hätten großen Spaß gehabt. Die sowjetische Presse verschwieg den Vorfall, während sich die westliche über die „Schusterdiplomatie“ halb ereiferte, halb amüsierte. Interessant ist, dass hier vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von „Diplomatie“ zum Ausdruck kamen. Während der konsternierte Chruščev meinte, die UNO sei ein Parlament wie das House of Commons in London, wo es zur Kultur des Hauses gehöre, durch Raunen, Rufen und Gesten seinen Unmut kundzutun, fand die westliche diplomatische Welt ihr Urteil bestätigt, dass der sowjetische Partei- und Regierungschef im besten Fall ein Politclown, im schlechtesten einfach unzurechnungsfähig sei. Der berühmte Vorfall in der UNO macht deutlich, dass auf westlicher Seite eine klare Norm diplomatischen Verhaltens existierte, an der Chruščev gemessen wurde, während dieser experimentierte, improvisierte und etwaige Normen ignorierte.