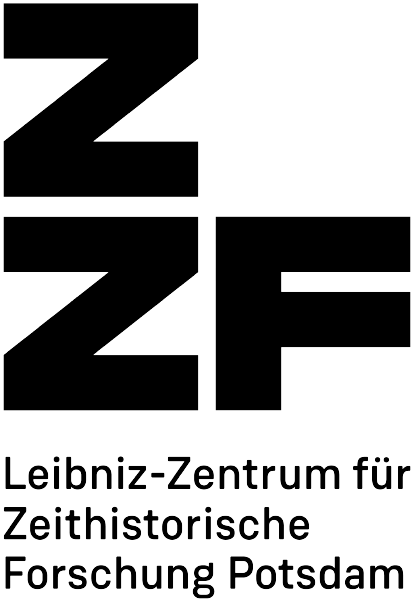Afrika
Refine
Year of publication
Document Type
- Journal Article (34)
- Online Publication (9)
- Part of a Book (2)
Keywords
Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland nehmen alle Bundesregierungen für sich in Anspruch, eine auf Frieden ausgerichtete Politik zu verfolgen. In Zeiten des Ost-West-Konflikts unterstützten sie in Afrika, Asien und Lateinamerika häufig aber auch autokratisch oder diktatorisch regierte Staaten mit fragwürdiger Menschenrechtsbilanz – darunter das seit 1962 unabhängige Ruanda. 1994 ließ dort eine verbrecherische Elite Hunderttausende Tutsi ermorden. Die Bundesregierung hatte die am Genozid beteiligte ruandische Armee zwischen 1978 und 1994 durch eine Bundeswehr-Beratergruppe in Kigali unterstützt. Schon zuvor hatte es Ausrüstungs- und Ausbildungshilfen gegeben. Die Auswertung kürzlich offengelegter Ministerialakten zeigt allerdings, dass die Bundesministerien weniger an einer Effizienzsteigerung der ruandischen Streitkräfte oder an einer Demokratisierung interessiert waren. In der Logik des Ost-West-Konflikts versuchten sie mit geringen Ressourcen gute Beziehungen zu pflegen und sich Rückhalt für eigene Positionen zu sichern. Aufgrund außenpolitischer Abwägungen hielt die Bundesregierung auch nach 1990 an der Militärkooperation fest. Von der Eskalation zum Genozid wurde sie überrascht.
Wer im Berliner Humboldt Forum nach der »Zukunft der Benin-Bronzen« sucht, stößt auf eine Galerie sprechender Köpfe. Der gleichnamige Saal im Ostflügel des Gebäudes präsentiert als sein zentrales Ausstellungsobjekt eine Reihe von zehn hochkant gestellten, in Augenhöhe angebrachten Monitoren, auf denen neben Hermann Parzinger als Repräsentant der Institution auch ein Vertreter des Königshauses von Benin sowie Kurator:innen und Wissenschaftler:innen aus Deutschland und Nigeria in wohlabgewogenen Statements ihre Sicht auf die Zukunft der umstrittenen Sammlungsobjekte schildern. Immer, wenn eine Person das Wort ergreift, wenden sich die anderen ihr aufmerksam zu.
After World War II, many historians in the German-speaking world thought of the relationship between anthropology and history as being largely synonymous with that of ›everyday life‹ (Alltag) and ›structure‹. As Jürgen Kocka (b. 1941) wrote in a retrospective statement to the Zurich historian Rudolf Braun (1930–2012), one of the few prominent figures of ›ethnographic‹ social history especially in the 1970s and 1980s: ›For while we, a younger generation of social historians, have turned to the large structures and processes that conditioned, encompassed and shaped people’s lives, Braun has always supported us, but he insisted – in an untimely but fruitful way – on not missing the people’s »inside«: the experiences and habits, the hopes and disappointments, the everyday life and mentalities of common people in the age of industrialization.‹
Der Nachlass des deutschen Kunstethnologen und Sammlers Hans Himmelheber (1908–2003) kam aus dem Privatbesitz seiner Familie an das Museum Rietberg Zürich. Ein Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Historischen Seminar der Universität Zürich begleitete die Archivwerdung von Himmelhebers Dokumenten, Filmen, Fotos und Objekten vor allem aus der heutigen Côte d’Ivoire und der Demokratischen Republik Kongo. Die darin reflektierte Wissensproduktion zur Kunst Afrikas wurde multiperspektivisch und translokal untersucht, etwa mit Restudies. Weil Himmelhebers Theorien am Beginn eines Paradigmenwechsels hinsichtlich der materiellen Kultur Afrikas standen, weg von einer als anonym wahrgenommenen »tribalen« Handwerkskunst hin zur individuellen Künstlerpersönlichkeit, spielten auch zeitgenössische und heutige künstlerische Positionen eine wichtige Rolle im Projekt. Das Archiv wurde zum Feld, das es in unterschiedlicher Weise zu erkunden galt. Unsere Reisen in dieses »Feld« sind nun wiederum Bestandteile des von den Nachkommen übergebenen und durch die Bearbeitung (auch digital) neu geschaffenen Archivs Himmelheber.
Im Rahmen der Ersten Deutschen Kolonialausstellung 1896 sollten rund zwei Millionen Besucher:innen sowohl durch die Kulissen im Treptower Park als auch durch Abbildungen auf Werbemedien von der „kolonialen Sache“ überzeugt werden. Wie jedoch versuchte die Kunstanstalt, die in ihrer Rolle als Werbepartner den Zielen des Veranstalters verpflichtet war, für die „koloniale Sache“ und gleichzeitig für einen Besuch der Veranstaltung zu werben?
Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen Motive waren die entscheidenden Faktoren. Sie hoben die Unterscheidungen zwischen der Repräsentation kolonialer Imaginationen und der Realität der Kolonialausstellung auf, indem die Kolonien über die Sujets der Bildpostkarten direkt in den Treptower Park versetzt wurden. Die Postkarten bildeten nicht nur die kunstvoll ausgestalteten Kulissen der Ausstellung ab, sie erschufen ein imaginiertes Idealbild der deutschen Kolonien. Die in der Ausstellung lediglich abstrakt zu greifende Veranschaulichung der Kolonialgebiete wurde in den Abbildungen zu einer scheinbar authentischen und geschlossenen Lebenswelt aufgewertet. Der vorliegende Text zeigt diese Verbildlichung eines „idealen“ Kolonialreichs am Beispiel einer Postkarte, auf der indigene Kulturgüter und -praktiken dargestellt und mit der „zivilisatorischen Mission“ an die Besucher:innen verknüpft wurden, weitere Kolonialgebiete zu erobern.
In Burundi steht ein überdimensionales Schwammerl. Ein Foto davon ist derzeit im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen, gemeinsam mit anderen Aufnahmen verschiedener Gebäude der Moderne in afrikanischen Staaten – sie sind Teil der aktuellen Ausstellung „Auf Augenhöhe – Afrika und seine Moderne“ mit Fotografien von Jean Molitor. Die Aufnahmen sind allerdings nicht nur für Liebhaber:innen steingewordener Fungi von Interesse, sondern genauso für Historiker:innen wie für die Zivilgesellschaft. Die Ausstellung konzentriert sich auf Fotografien moderner Gebäude, die der Fotograf auf seinen Reisen in afrikanischen Staaten anfertigte. Neben den Gebäuden zeigt die Ausstellung eine Collage von Straßenfotografien sowie wenige Fotos und Videoaufnahmen von Molitors Reisen samt den Menschen, denen er dabei begegnete. Besucher:innen lernen so die Umgebung der dokumentierten Gebäude kennen und die Umstände, unter denen die Aufnahmen entstanden.
Ziel meines Forschungsprojekts ist es, Kolonialfotografien von Menschen und Landschaften Kameruns, die zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs produziert wurden, zu untersuchen. Vor dem Hintergrund der aktuellen – nicht nur in Deutschland – geführten Debatten über das unzureichend aufgearbeitete „Erbe“ des Kolonialismus ist dieses Thema von hoher Aktualität. Die Vielfalt deutscher Kolonialbilder zu Kamerun ist Ausgangspunkt des Forschungsprojekts. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Rolle kolonialer Bilder in der Vermittlung anthropologischen Wissens über Menschen fremder Herkunft im Kontext europäischer bzw. deutscher Kolonialherrschaft.
Kämpfe um Rückführungen prägen das europäische Grenzregime des 21. Jahrhunderts. Wie wir mit dem Konzept der Rückführbarkeit (Returnability) herausarbeiten, kommen dabei »sanfte« Instrumente der sogenannten Rückkehrförderung ebenso zum Einsatz wie gewaltsame Abschiebungen. Diese werden von migrantischen Widerständen herausgefordert. Zentrale Auseinandersetzungen in diesem Rückführungsregime analysieren wir im Zentrum der Europäischen Union und an ihren Rändern: Für Deutschland betrachten wir am Beispiel der bayerischen »Anker-Zentren« die Mikrophysik der Macht in Sammelunterkünften, Rückkehrberatung und Abschiebevollzug. Für Tunesien zeigen wir, wie staatliche Instrumente der Inhaftierung und Abschiebung durch internationale Programme und informelle Praktiken zur Unterstützung »freiwilliger Rückkehr« ergänzt werden. Unsere sozialwissenschaftliche Untersuchung stützt sich auf teilnehmende Beobachtungen, Interviews und schriftliche Quellen. Zeithistorisch bezieht sie die administrativen, diskursiven und politischen Voraussetzungen des heutigen Grenzregimes ebenso mit ein wie die migrantischen Handlungsspielräume und Widerstandspraktiken.