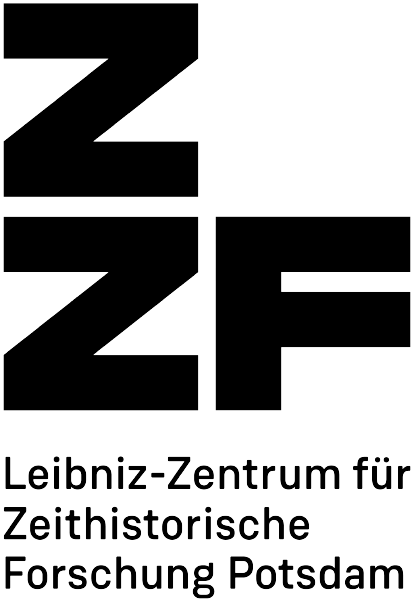Wissen
Refine
Year of publication
Document Type
- Journal Article (87)
- Online Publication (9)
- Book (2)
- Part of a Book (2)
Keywords
Grenzgänger des Wissens. Zur Historizität und Aktualität von Hans Peter Duerrs »Traumzeit« (1978)
(2025)
»Innerhalb kürzester Zeit wurden 150.000 Exemplare verkauft, so etwas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.« Mit diesen Worten blickte der Ethnologe Hans Peter Duerr im Jahr 2009 auf sein Werk »Traumzeit« zurück, dessen Strahlkraft sich an den unzähligen Besprechungen in Fachzeitschriften und Feuilletons ablesen lässt. Der 1978 im linken, westdeutschen Syndikat Verlag publizierten Erstausgabe folgten in wenigen Jahren fünf weitere Auflagen. 1985 erschien eine Neuausgabe bei Suhrkamp, die ihrerseits stetig nachgedruckt wurde (zuletzt 2021 bzw. seither als Print on Demand), und zudem eine Übersetzung ins Englische. Auf dem Rücken des roten Suhrkamp-Bandes prangt der Tribut der Schweizer Zeitung »Die Weltwoche« an ein »mittlerweile berühmt gewordenes Kultbuch«. Während der Paratext die »Traumzeit« diskursiv in die luftigen Höhen eines wie auch immer definierten Kanons erhebt, tat der Bergsteiger Reinhold Messner dies 1979 ebenso performativ wie wörtlich, indem er das Buch in seinem Rucksack zusammen mit Werken von Platon und Tolstoi auf den K2 trug. Auch wenn Duerr partout keinen »Klassiker« geschrieben haben will, muss er sich heute das Etikett des »meist gelesenen Ethnologen der deutschen Nachkriegszeit« gefallen lassen. Kurz: Bei der »Traumzeit« handelte es sich, um die Wortschöpfung eines Fachrezensenten zu gebrauchen, fraglos um einen »Ethnobestseller«, der auch als solcher beworben wurde.
Wer im Berliner Humboldt Forum nach der »Zukunft der Benin-Bronzen« sucht, stößt auf eine Galerie sprechender Köpfe. Der gleichnamige Saal im Ostflügel des Gebäudes präsentiert als sein zentrales Ausstellungsobjekt eine Reihe von zehn hochkant gestellten, in Augenhöhe angebrachten Monitoren, auf denen neben Hermann Parzinger als Repräsentant der Institution auch ein Vertreter des Königshauses von Benin sowie Kurator:innen und Wissenschaftler:innen aus Deutschland und Nigeria in wohlabgewogenen Statements ihre Sicht auf die Zukunft der umstrittenen Sammlungsobjekte schildern. Immer, wenn eine Person das Wort ergreift, wenden sich die anderen ihr aufmerksam zu.
After World War II, many historians in the German-speaking world thought of the relationship between anthropology and history as being largely synonymous with that of ›everyday life‹ (Alltag) and ›structure‹. As Jürgen Kocka (b. 1941) wrote in a retrospective statement to the Zurich historian Rudolf Braun (1930–2012), one of the few prominent figures of ›ethnographic‹ social history especially in the 1970s and 1980s: ›For while we, a younger generation of social historians, have turned to the large structures and processes that conditioned, encompassed and shaped people’s lives, Braun has always supported us, but he insisted – in an untimely but fruitful way – on not missing the people’s »inside«: the experiences and habits, the hopes and disappointments, the everyday life and mentalities of common people in the age of industrialization.‹
In this article, we provide a new approach to circular economy in architecture based on the juxtaposition of historical sources and ethnographic data. We bring into dialogue historical practices of rubble reuse in Warsaw after the Second World War with contemporary efforts to salvage components in buildings slated for demolition in Vienna. The analysis of archival and published documents, construction and architecture magazines, and visual sources is combined with a participant observation in a start-up company in Vienna. Our research methods have led us to respond critically to the solutions presented by the current debates on the reuse of construction and demolition waste. For past and present reuse practices, we uncover and scrutinise a complex social and bodily reality often obscured by the images of seamless and endless circulation of construction materials promoted by policymakers, industry leaders, architecture professionals, and positivist academic researchers.
Der Nachlass des deutschen Kunstethnologen und Sammlers Hans Himmelheber (1908–2003) kam aus dem Privatbesitz seiner Familie an das Museum Rietberg Zürich. Ein Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Historischen Seminar der Universität Zürich begleitete die Archivwerdung von Himmelhebers Dokumenten, Filmen, Fotos und Objekten vor allem aus der heutigen Côte d’Ivoire und der Demokratischen Republik Kongo. Die darin reflektierte Wissensproduktion zur Kunst Afrikas wurde multiperspektivisch und translokal untersucht, etwa mit Restudies. Weil Himmelhebers Theorien am Beginn eines Paradigmenwechsels hinsichtlich der materiellen Kultur Afrikas standen, weg von einer als anonym wahrgenommenen »tribalen« Handwerkskunst hin zur individuellen Künstlerpersönlichkeit, spielten auch zeitgenössische und heutige künstlerische Positionen eine wichtige Rolle im Projekt. Das Archiv wurde zum Feld, das es in unterschiedlicher Weise zu erkunden galt. Unsere Reisen in dieses »Feld« sind nun wiederum Bestandteile des von den Nachkommen übergebenen und durch die Bearbeitung (auch digital) neu geschaffenen Archivs Himmelheber.
»There is nothing new or eccentric about the suggestion that historians might profit from an acquaintance with anthropology«, schrieb der britische Sozial- und Kulturhistoriker Keith Thomas 1963. Er bezog sich damit seinerseits auf Debatten der 1930er-Jahre, die von dem Wirtschafts- und Sozialhistoriker Richard Henry Tawney angeregt worden waren, der damals an der London School of Economics wirkte. Thomas fügte jedoch sogleich hinzu, dass der Vorschlag einer engeren Verbindung von Geschichte und Anthropologie selten in die Praxis umgesetzt werde.
Die Frage, wie menschliches Verhalten beeinflusst werden kann, ist in der jüngsten Zeitgeschichte virulenter geworden. Auf der Basis verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse versprechen Expert:innen, Menschen durch subtile Interventionen glücklicher, gesünder und wohlhabender zu machen. Zugleich haben die Digitalisierung und Datafizierung unserer Welt Ängste vor einer umfassenden Verhaltensmanipulation und -kontrolle verschärft. Das Buch zeigt, dass es keineswegs selbstverständlich ist, Menschen nicht als handelnde Subjekte, sondern als sich verhaltende Organismen zu begreifen. Es untersucht, wie seit der Behavioral Revolution in der Mitte des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Wissensfeldern, von den Wirtschafts- über die Psychowissenschaften bis zur Kriminologie, ein spezifisches Verhaltenswissen entwickelt wurde. Davon ausgehend analysiert es dessen Bedeutung für den Wandel politischer Steuerungstechniken vor allem in Bezug auf das Umwelt-, Gesundheits- und Finanzverhalten seit den 1970er Jahren.
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno schrieben die »Dialektik der Aufklärung« vor acht Jahrzehnten in der Emigration, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie war als eine Art »Flaschenpost« gedacht, die dann tatsächlich im Zuge der studentischen Protestbewegung der 1960er-Jahre entkorkt wurde – durchaus gegen Widerstände von Horkheimer, der aktivistischen Missbrauch von Gedanken aus einem anderen Kontext befürchtete. Seitdem gilt die Schrift, in der »die Aufklärung« – verstanden als das menschliche Bestreben, sich mittels Naturbeherrschung und Vernunft zu emanzipieren – einer Selbstkritik unterworfen wird, als ein Klassiker der Sozialphilosophie, der immer wieder neu gelesen, oft als antiquierte Kulturkritik verworfen wird und gleichwohl auch immer wieder neue Liebhaber findet.
Populäre Wissenschaft. Das »Fischer Lexikon A-Z« im Taschenbuchmarkt der frühen Bundesrepublik
(2024)
Der Beitrag untersucht die Popularisierung von wissenschaftlichem Wissen durch die noch junge Publikationsform Taschenbuch in der frühen Bundesrepublik. Am Beispiel des 40-bändigen »Fischer Lexikons A-Z«, das der S. Fischer Verlag ab 1957 auf den Markt brachte, wird gezeigt, wie es einem zuvor auf literarische Werke konzentrierten Publikumsverlag gelang, in bis dahin nicht gekannten Auflagenhöhen und durch ubiquitäre Vertriebswege einem breiten Publikum wissenschaftliche Erkenntnisse nahezubringen. Im Unterschied zu den populärwissenschaftlichen Büchern oder Broschüren des 19. Jahrhunderts kam das »Fischer Lexikon« ohne übermäßig starke Komplexitätsreduktion aus und wurde dennoch ein großer verlegerischer Erfolg – besonders dank der Bildungsexpansion der 1960er- und 1970er-Jahre. Allein bis 1969 betrug die Gesamtzahl der gedruckten Bände der Lexikon-Reihe etwa 5,4 Millionen Exemplare. Die verlegerischen Strategien werden ebenso erläutert wie die Reflexion der im Wissenschaftsbetrieb anfangs ungewohnten Publikationsform Taschenbuch durch die Autoren und Herausgeber.
Ganz im Freud’schen Sinne war die deutsche Sprache für Theodor W. Adorno das von Anfang an Vertraute, das vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus, der Erfahrung von Verfolgung und Exil sowie dem Wissen um die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden jedoch zum Unvertrauten wurde. Gerade deshalb, so könnte man meinen, hielt Adorno beharrlich am Ideal eigener, »authentischer« Sprachverwendung als Muttersprachler fest, als sei seine Sprache ein autonomer Bereich. Zugleich richtete sich seine Sprachkritik aber gleichsam »objektiv« auf den mit formelhafter Sprachverwendung einhergehenden gesellschaftlichen Erfahrungsverlust. Unter dieser spannungsreichen Doppelperspektive reflektierte Adorno sein Verhältnis zur deutschen Sprache und die Funktion von Sprache als Medium des Denkens in einer Vielzahl von Texten. Während in einigen davon das Deutsche als Muttersprache vor allem ein identitätsstiftendes Moment bedeutet und als biographische Klammer nach der Zäsur von Exil und Holocaust eine Verbindung zur Kindheit herstellt, steht einem solchen emphatischen Verständnis des Deutschen die Analyse entleerter, formelhafter Sprachverwendung in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft gegenüber. So deutet sich an, dass der Remigrant Adorno in der verwalteten Welt nach dem »Zivilisationsbruch« (Dan Diner) in der deutschen Sprache sprachmächtig agieren konnte, während er zugleich einen allgemeinen Erfahrungsverlust konstatierte. Der Spannung, ja dem Changieren Adornos zwischen radikaler Sprachkritik einerseits und Idealisierung der deutschen Muttersprache andererseits möchte ich hier in fünf Schritten nachgehen.