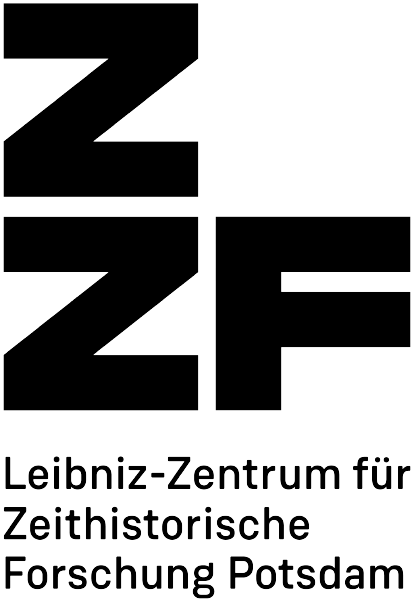Race
Refine
Year of publication
Document Type
- Journal Article (28)
- Online Publication (9)
- Part of a Book (5)
For this article, I would like to present the process of my becoming aware of the work of Charlotte Paige Carroll, an African American woman photographer active in Chicago during the 1920s-1940s. This period, notably marked by the Harlem Renaissance – a flourishing of African American art and culture – fostered a modern Black subjectivity known as the “New Negro”. More of an international movement of Black consciousness than a phenomenon that was limited to a particular geography, the Harlem Renaissance promoted a period of cultural growth, economic investment and political agency. It is within this context that Carroll, with her partner J.C. Schlink, owned and operated Electric Studio. Electric Studio’s photographs were published in nationally circulating newspapers and magazines, and aspects of Carroll’s life were chronicled in the Black media of the day, yet despite the significant contributions of Carroll or Electric Studio their extensive efforts do not appear in the chronicle of photography’s history. For numerous reasons this absence is a history in and of itself that necessitates careful consideration in both methodology and approach.
This article examines the appropriation of the slogan ›Black is beautiful‹, which had its origins in the US Civil Rights movement, by the West German Christian Democrats in the 1970s – and thus by a party led by white men. The analysis brings into conversation histories that have mostly been treated separately: the political history of the Federal Republic and the Christian Democrats; the history of political chromatics and political communication; and the history of racism and anti-racism in Germany after 1945. While the focus is on a specific election campaign that ran from 1972 to 1976, the aim is to address larger issues: the first decade of the Christian Democrats in opposition at the federal level and their struggle to appear ›modern‹ in a period of rapid change; and constructions of race in a society that had banned the word ›Rasse‹ from its political vocabulary. One conclusion is that the ›Black is beautiful‹ campaign was in many ways a typical product of the Federal Republic in the 1970s. The ways in which the Christian Democrats dealt – or did not deal – with ›race‹ in this instance reflects a general reluctance among West Germans to acknowledge the more subtle forms that racism has taken since 1945, other than state-sanctioned discrimination.
Das westdeutsche Abschieberegime entstand im Kontext der Problematisierung von People of Color, die seit 1950 in die Bundesrepublik einreisten, um dort ein Studium oder eine Ausbildung aufzunehmen. Die junge Republik lud Menschen aus sich dekolonisierenden Ländern zunächst ein, um sich von der Rassenideologie des National- sozialismus zu distanzieren und sich gegenüber dem Sozialismus zu profilieren. Dabei bestand jedoch weiterhin die im Kern völkische Prämisse, dass People of Color nicht langfristig bleiben sollten. Die Herstellung ihrer Rückführbarkeit manifestierte sich in der Rechts-, Verwaltungs- und Betreuungspraxis lokaler Behörden und Wohlfahrtsverbände, wodurch diese Prämisse in das Ausländergesetz von 1965 einging. Das Gesetz machte insbesondere »außereuropäische« Migrant*innen abschiebbar, denen es pauschal kriminelle Täuschungsabsichten und extremistische Politisierung unterstellte. Es verrechtlichte zudem eine pseudomoralische Rückkehrpflicht von People of Color unter Verweis auf ihren Entwicklungsauftrag in den Herkunftsländern und auf tradierte Geschlechterrollen. Diese Normen waren in der Bundesrepublik permanent abrufbar und wurden sukzessive auf andere Migrant*innen angewandt.
Ausweisungen können weitere politische Funktionen einnehmen, die über die staatliche Steuerung von Migration hinausgehen. Wie wir in diesem Aufsatz anhand zweier Sondertypen von Ausweisungen zeigen, können solche Maßnahmen gerade in Phasen staatlicher Konsolidierung und bei der Überlappung von Souveränitätsansprüchen als politisches right-peopling auftreten. In diesem Kontext untersuchen wir die Rolle von Ausweisungen während der kritischen Phase der deutschen Nationalstaatsbildung nach dem Ersten Weltkrieg. Für die 1920er-Jahre analysieren wir einerseits Ausweisungen von Deutschen aus anderen Landesteilen durch deutsche Landesbehörden (etwa von Württembergern aus Baden), andererseits Ausweisungen von Deutschen aus dem besetzten Rheinland durch die alliierten Besatzungsbehörden. Mit Bezug auf aktuelle Debatten um Illegalisierung und deportability von Migrant*innen betrachten wir Beispiele aus regional- und rechtshistorischen Quellen der Weimarer Republik. So zeigen wir, wie Ausweisungen sozialpolitische und ethnisch-exklusive Ziele hatten, aber auch zu einer Stärkung staatlicher Institutionen und zu einer nationalistischen Identifikation mit dem Deutschen Reich nach dem verlorenen Krieg führten.
Cemal Kemal Altun nahm sich am 30. August 1983 durch einen Sprung aus dem sechsten Stock des Berliner Verwaltungsgerichts das Leben. Damit wollte er seiner Abschiebung in die Türkei und der dort drohenden Folter entgehen. Dreizehn Monate Auslieferungshaft und ein zermürbendes Rechtsverfahren machten den »Fall Altun« zum Symbol der Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit bundesdeutscher Ausweisungspraxis. Der Hohe Kommissar für Flüchtlingsfragen der Vereinten Nationen ermahnte die deutschen Behörden, ihre inhumane Behandlung von Migrant*innen zu beenden. Der Europarat protestierte, und die Europäische Kommission für Menschenrechte in Straßburg wurde hinzugezogen. In der Bundesrepublik traten Aktivist*innen in Hungerstreik, und etwa 10.000 Menschen setzten ein Zeichen, als sie Altuns Leichenzug durch West-Berlin in einen Protestmarsch verwandelten. Anti-Abschiebe-Proteste nahmen zu und institutionalisierten sich Mitte der 1980er-Jahre in Form von Kirchenasyl, Flüchtlingsräten, Pro Asyl, Fluchtburg-Bewegung, migrantischer Selbstorganisation und antirassistischen Initiativen.
Zwischen Weihnachten und Neujahr 1982 und 1983 fand im Frankfurter Theater am Turm (TAT) jeweils das Festival Stern.Zeichen statt, das im Untertitel „Homosexualität im Theater“ hieß. Zu den großen Entdeckungen der ersten Ausgabe zählte Georgette Dee, jene androgyne Künstler*in, die seit den frühen 1980er Jahren in ihren Bühnenauftritten unterschiedlichste Facetten von Geschlechtlichkeit aufführt, die sich nicht in einer einzelnen Identitätskategorie auflösen lassen. Für die zweite Ausgabe 1983 wurde Georgette Dee eingeladen, eine Weihnachts-Gala zu moderieren (und zu organisieren). Die Beschreibung des Auftritts lässt erahnen, mit welchem Glitter, Glamour und Camp hier gegen Heteronormativität angespielt und angesungen wurde.
As the biggest commercial city in Tanzania today, Dar es Salaam features a number of German colonial memory sites which range from buildings, statues to open spaces. Formerly existing as a small caravan town exclusively owned by the Arab Sultan of Zanzibar, Dar es Salaam was further developed by the Germans who used it as their capital (Hauptstadt) beginning in the late 19th century. After the WWI, the city continued to serve as the capital in British mandate period until it was inherited by the independent government of Tanzania in 1961.
Dieser Aufsatz erklärt die enorme Resonanz von Günter Wallraffs Bestseller »Ganz unten« (Erstausgabe 1985) mit den emotionalen Bedürfnissen und der soziokulturellen Verfasstheit der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft. Das Buch artikulierte soziale Abstiegsängste während einer wirtschaftlichen Strukturkrise mit hoher Arbeitslosigkeit. Es präsentierte eine binäre Weltsicht, die die expressive Emotionskultur der 1980er-Jahre reflektierte. Die nahezu apokalyptische Darstellung der westdeutschen Industriegesellschaft und ihres menschenverachtenden Umgangs mit migrantischen (Leih-)Arbeitern stand im Einklang mit der Weltsicht eines wachsenden grün-alternativen Milieus. Im Gegensatz zur populären Erinnerung war das Buch jedoch kein Wendepunkt in der öffentlichen Repräsentation der türkischen »Gastarbeiter«, für deren Erfahrungen Wallraff nach seiner Undercover-Recherche als »Ali« zu sprechen schien. Vielmehr verdeutlichte »Ganz unten« massive Defizite im Umgang mit Differenz in der bundesrepublikanischen Gesellschaft der 1980er-Jahre, gerade auch auf der Linken. Nicht Wallraffs Buch, sondern die damalige, bisher vernachlässigte deutsch-türkische Kritik daran markiert eine historisch signifikante antirassistische Traditionslinie, die bis in die Gegenwart reicht.
Bei seiner Erstveröffentlichung stieß Michele Wallaces Buch »Black Macho and the Myth of the Superwoman« auf ein geteiltes Echo. Während Vertreterinnen der Frauenbewegung den Text als Markstein der (afroamerikanischen) feministischen Literatur feierten, als der er auch heute noch betrachtet wird, schallte der Autorin aus anderen Teilen der Öffentlichkeit vor allem Kritik entgegen. In »Black Macho« setzte sich Wallace provokant mit dem geschlechterpolitischen Erbe der Bürgerrechtsbewegung auseinander. Vor allem die Black-Power-Bewegung habe ein Ideal schwarzer Hypermaskulinität hervorgebracht, das afroamerikanische Männer in ihren Entwicklungspotentialen beschränke und schwarze Frauen dauerhaft in traditionellen Rollen an den Rändern einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung gefangen halte. Wallace interessierte sich besonders für die intersektionalen Verflechtungen von Race, Class und Gender, die afroamerikanische Frauen und Männer auf unterschiedliche Art und Weise marginalisierten. Ihr Buch war zugleich eine Abrechnung mit der US-amerikanischen Gesellschaft, in deren Selbstverständnis, so Wallace, Rassismus und Sexismus seit der Kolonialzeit fest verankert waren und die People of Color seit Jahrhunderten strukturell benachteiligte.