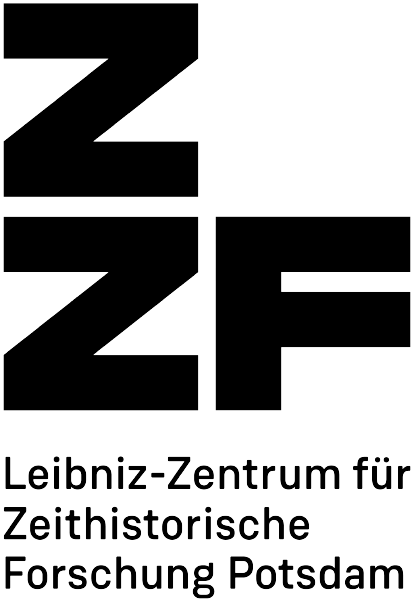1970er
Refine
Year of publication
Document Type
- Journal Article (135)
- Part of a Book (77)
- Online Publication (40)
- Book (21)
Keywords
- Deutschland (DDR) (8)
- Deutschland (Bundesrepublik) (6)
- Berlin (West) (2)
- Computer (2)
- Deutschland (2)
- Adoption (1)
- Amerikaner (1)
- Anders, Günther (1)
- Arbeiterbewegung (1)
- Arbeitsbedingungen (1)
Kommentar zur Quelle: Quelle: Bekennerschreiben der Europäischen Befreiungsfront (Faksimile), in: Berliner Extra-Dienst, Nr. 13/V vom 17. Februar 1971 (Sammlung Emil Julius Gumbel Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien Potsdam).
Based on scholarship from across the disciplines, this article calls attention to examples of gender-themed comics from the era of second-wave feminism with the aim of bringing them into our thematic dossier’s wider discussion of “seeing” the history of women, gender, and sexuality through visual sources. I will suggest how a focus on women’s comics brings new perspectives to historians’ understanding of second-wave feminism, its origins, and its contestations. I will begin by looking at scholarship on some of the key moments in the production and reception of women’s comics in the U.S., putting this in comparative context by looking a few examples from France. I then discuss American feminists’ embrace of and objections to women’s comics, as well as rifts within the community of women comic artists and readers of comics. I will then briefly exemplify two themes that women comic artists explored – body image and motherhood – pointing to the complicated place of these themes in relationship to the broader feminist critique. I will end with a brief note on legacies of and pushbacks against second-wave feminism as they appear in the realm of comics.